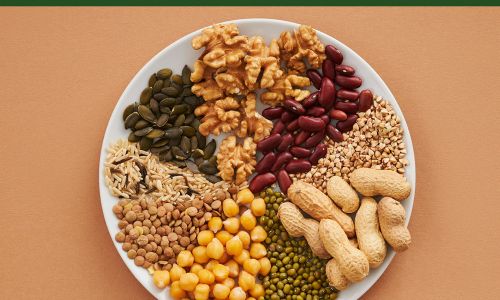Was uns beim Essen wichtig ist: Die Ergebnisse der Ernährungsstudie der Robert Bosch Stiftung

Die gesellschaftliche Debatte um Ernährung ist oft emotional und polarisiert. Die neue Studie „Meine, deine, unsere? Was uns als Gesellschaft beim Thema Ernährung wichtig ist“, die im Auftrag der Robert Bosch Stiftung von More in Common und Verian (ehemals Kantar Public) durchgeführt wurde, liefert ein differenziertes Bild über das Ernährungsverhalten und die Wünsche der Menschen in Deutschland.
Die Ergebnisse der Befragung von 2.020 Menschen im Herbst 2024 zeigen eine komplexe Spannung zwischen dem starken Wunsch nach persönlicher Autonomie und der gleichzeitigen Forderung nach gesellschaftlicher und politischer Gestaltung.
Persönliche Entscheidung: Zufriedenheit und Alltags-Hürden
Ernährung ist in erster Linie ein hochpersönliches Thema.
- Bewusstsein und Zufriedenheit: 84 Prozent der Befragten geben an, häufig oder gelegentlich bewusst über ihre Ernährung nachzudenken. Die meisten Menschen (62 Prozent) sind mit ihrer Ernährung zufrieden. Allerdings sehen fast die Hälfte (49 Prozent) ihrer Ernährung dennoch als veränderungsbedürftig an.
- Prioritäten: Die Zufriedenheit ist am höchsten bei unmittelbar persönlichen Kriterien: Das Essen ist lecker genug (95 Prozent), bezahlbar genug (74 Prozent) und gesund genug (66 Prozent)
- Herausforderungen: Zeit- und Geldmangel sind die größten Hindernisse, die viele Menschen davon abhalten, sich ihren Idealvorstellungen entsprechend zu ernähren. Die Möglichkeit, den eigenen Anspruch einer guten Ernährung zu erfüllen, hängt auch stark vom Geldbeutel ab.
Die Debatte: Angst vor Abwertung erfordert Respekt
Der innergesellschaftliche Vergleich zeigt ein Abwertungspotenzial beim Thema Ernährung.
- Gefühl der Überlegenheit: Ein beachtlicher Anteil von 34 Prozent hat jedoch das Gefühl, sich besser als der Rest zu ernähren. Dies, sowie die Tatsache, dass 74 Prozent negative Gefühle gegenüber Menschen hegen, die sich hauptsächlich von Fast Food ernähren, verdeutlicht die Sensibilität des Themas und die Angst vor gegenseitigen Urteilen.
- Forderung an den Diskurs: Die Studienautoren betonen, dass es eine Haltung des Respekts und der Achtung von Lebensentscheidungen braucht, um die Debatte konstruktiv zu führen. Allzu frontale Belehrungen werden von der Bevölkerung abgelehnt.
Politik im Dilemma: Gestaltungswunsch und Skepsis
Die Menschen bewegen sich in einem Spannungsfeld zwischen dem Wunsch nach politischer Rahmung und der Sorge vor Übergriffen.
- Handlungsbedarf vs. Heraushalten: 56 Prozent der Befragten stimmen eher der Aussage zu, dass sich die Politik aus ihrer Ernährung heraushalten sollte. Gleichzeitig sehen immerhin 38 Prozent großen politischen Handlungsbedarf in der Art und Weise, wie sich die Gesellschaft ernährt.
- Ideale Zukunft: Die ideale Ernährung der Zukunft sollte an erster Stelle gesund (66 Prozent), regional (51 Prozent) und günstig (36 Prozent) sein.
- Handlungsmacht: Mehrheiten sind überzeugt, mit ihrer Ernährung einen Unterschied machen zu können, etwa für das Tierwohl (63 Prozent) und den Klima- und Umweltschutz (52 Prozent).
Die Studie kommt zum Fazit, dass die Debatte komplex ist, aber großes Potenzial birgt. Um Akzeptanz für Veränderungen zu schaffen, müssen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft gemeinsam faire Rahmenbedingungen schaffen, die eine bewusste, gesunde und gerechte Ernährung für alle ermöglichen.